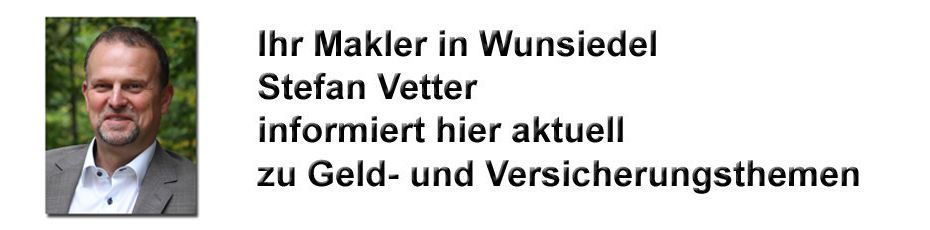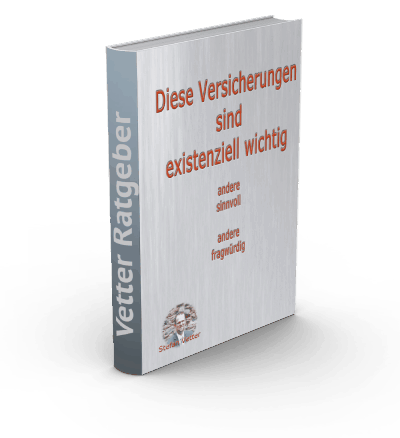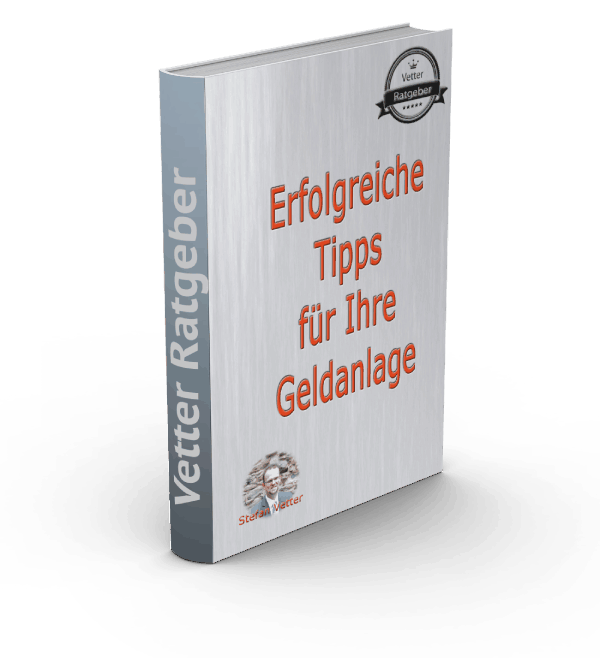Berufsunfähigkeit und Alkoholsucht
Jeder vierte Erwerbstätige hierzulande ist in seinem Arbeitsleben von Berufsunfähigkeit betroffen, sei es nur für einen gewissen Zeitraum oder generell. Hauptauslöser sind psychische Erkrankungen wie beispielsweise Alkoholsucht.
Alkoholsucht ist anerkannte Erkrankung
Alkoholsucht wurde im Jahr 1968 vom Bundessozialgericht als Krankheit anerkannt. Mit rund 1,6 Millionen Betroffenen gehört sie zu den häufigsten chronischen Erkrankungen. Die Einstufung durch die Weltgesundheitsorganisation WHO erfolgte unter ICD-10 als "(F10) Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol". ICD steht für "International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems" und bildet ein weltweit einheitliches System zur Klassifikation von Gesundheitsproblemen und Krankheiten. Sie stellt für Ärzte, Krankenhäuser und Versicherer einen durchgängigen Diagnoseschlüssel dar.
Definition von Berufsunfähigkeit
In den aktuellen Vertragswerken der Lebensversicherer definiert sich die bedingungsgemäße Berufsunfähigkeit (BU) folgendermaßen: ist der Versicherte aufgrund von Unfall, Krankheit oder Kräfteverfall außerstande, seinen zuletzt ausgeübten Beruf, für die Dauer von mindestens sechs Monaten zu weniger als 50 Prozent nachzugehen. Zudem ist der sog. Verzicht auf abstrakte Verweisung mittlerweile bei nahezu allen Tarifen ausgeschlossen, d. h. die Versicherungsgesellschaft kann nicht verlangen, dass der Betroffene einen anderen Beruf ausübt, auch wenn das möglich ist.
Alkoholsucht kann die bedingungsgemäße Grundlage erfüllen, wenn die Krankheit zu körperlichen Folgeerkrankungen, kognitiven Problemen oder psychischen Begleiterscheinungen, wie Angststörungen, Depressionen o. ä. führt. In schweren Fällen können in Folge erhebliche funktionelle Einschränkungen auftreten bis hin zur völligen Arbeitsunfähigkeit. Mittlerweile erkennen Gerichte Alkoholsucht mitunter als möglichen Auslöser für eine BU an. Entscheidend ist jedoch immer der Nachweis, dass die Erkrankung in ihrer Ausprägung tatsachlich die Arbeitsfähigkeit in der konkret verübten Tätigkeit erheblich einschränkt.
Vorvertragliche Anzeigepflichtverletzung
Ein häufiger Streitgegenstand bei Gerichtsverfahren ist die sog. vorvertragliche Anzeigepflicht. Bereits im BU-Versichertenantrag stellt die Gesellschaft dem Versicherungsnehmer Fragen zu seinem Gesundheitszustand, die er wahrheitsgemäß beantworten muss. Dabei geht es auch um bestehende oder frühere Suchterkrankungen. Verpflichtend ist ebenfalls die Offenlegung vorheriger Entzugsbehandlungen oder psychotherapeutischen Maßnahmen im nachgefragten Zeitraum meist von zehn Jahren.
Stellt sich im Leistungsfall heraus, etwa anhand ärztlicher Unterlagen, dass eine Alkoholsucht verschwiegen wurde, so kann die Versicherungsgesellschaft den Vertrag anfechten oder ggf. davon zurücktreten. Dies ist auch dann möglich, wenn die BU auf einer anderen Ursache beruht.
Vorsätzliche Herbeiführung
Die Leistungspflicht in der BU-Versicherung besteht im Grundsatz unabhängig davon, wie der Versicherungsfall eingetreten ist. Häufig gibt es jedoch Risikoausschlüsse, wie der einer vorsätzlichen Herbeiführung. Hierbei argumentieren die Versicherer gerne damit: "Der Betroffene habe durch anhaltenden Alkoholkonsum seine Berufsunfähigkeit selbst verschuldet."
Zu Beginn der Sucht trifft meist der Vorwurf einer Absicht oder groben Fahrlässigkeit auf das reine Konsumieren zu. Dagegen muss sich der Vorsatz auf eine Herbeiführung der BU nicht nur auf die zugrunde liegende Gesundheitsbeeinträchtigung richten und eben dieser Faktor liegt meist nicht vor. Damit fehlt es am für den Vorsatz erforderlich gewollten und bewussten Herbeiführen des Leistungsfalls. Auch obliegt der Versicherungsgesellschaft der Beweis für ein entsprechendes Verhalten des Versicherungsnehmers, wenn er sich auf den Ausschluss beruft.